Wenn man einen Begriff zum ersten Mal hört oder liest, hat man meist eine ungefähre Ahnung davon, was er bedeutet. Im konkreten Fall von Gamification liegt die Assoziation zum Spielen nahe. Beide Begriffe beschäftigen sich allerdings mit völlig unterschiedlichen Themen.
Spiele haben einen ganz klaren pirmären Nutzen: Unterhaltung. Es gibt zwar Spiele, die auch Lerninhalte transportieren. Dennoch ist und bleibt das wichtigste Ziel von Spielen die Unterhaltung der User, selbst wenn es sich um Lernspiele handelt.
Bei Gamification dreht es sich um die Anwendung von Spielmechaniken im Kontext professioneller Anwendungen. Es geht hier also nicht darum, die Nutzer:innen zu unterhalten. Hier wird der Fokus darauf gesetzt, den Nutzer:innen die Inhalte der Anwendungen möglichst spielerisch und leicht zugänglich zu machen. Hierfür ist ein gutes Verständnis der Nutzer:innen und ihres Kontexts nötig. Die Einführung von Abzeichen alleine führt noch lange nicht zu einer effizienten Gamification.
Welchen Nutzen hat Gamification?
Einen wesentlichen Nutzen von Gamification habe ich bereits angesprochen. Ein Aspekt von Gamification kann sein, den Nutzer:innen die Inhalte der Anwendung zu präsentieren und sie bei der Einarbeitung in neue Features oder Themenbereiche zu unterstützen. So fällt ihnen das Kennenlernen neuer Inhalte leichter. Wenn sich so bereits die ersten Schritte gut anfühlen, werden zwei Dinge gleichzeitig erreicht: zum einen werden die sich Nutzer:innen besser und genauer in die neuen Inhalte einarbeiten, zum anderen werden sie sich das Erlernte besser merken.
Außerdem kann mit einem geeigneten Einsatz von Gamification-Elementen die Interaktion mit den Nutzer:innen gezielt angesprochen werden. Ein Beispiel hierfür ist Fiats Eco:Drive. Beim Fahren mit dem Auto bewertet das System die Umweltfreundlichkeit des Fahrverhaltens und zeigt dem oder der Fahrer:in dies in Form von Punkten, CO2-Einsparung usw. an. Je klimafreundlicher der Fahrstil, besser ist ihr EcoIndex. Zusätzlich kann man sich so mit anderen Fahren vergleichen. Über diesen “Wettbewerb” werden die Fahrer dazu motiviert, möglichst umweltfreundlich, also ressourcensparend zu fahren.
Ein weiterer Nutzen kann darin liegen, dass Nutzer:innen möglichst viel Zeit in der Anwendung verbringen sollen, wenn sie sich darin wohl fühlen und durch gewisse Ziele motiviert sind. Dies gilt besonders für Anwendungen mit Lehrcharakter wie E-Learning-Systeme. Ein Beispiel hierfür ist die App Duolingo zum Lernen von Fremdsprachen. Hier sind viele Spielmechaniken implementiert.
Nicht zuletzt fokussieren sich Nutzer:innen durch einen guten Einsatz von Gamification-Elementen bei der Bewältigung langwieriger oder potenziell langweiliger Arbeiten besser auf ihre Arbeit. So kann z.B. bei sich wiederholenden Arbeitsschritten die Konzentration der Nutzer:innen durch den Einsatz von Spielmechaniken erhöht und die Fehlerquote gesenkt werden.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass durch den gezielten Einsatz von Gamification die Nutzer:innen intrinsisch motiviert werden, die Anwendung zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der gezielte Einsatz von Spielelementen und -mechaniken ein gutes Werkzeug.
Beispiele für Spielmechaniken
Es gibt eine ganze Reihe von Spielmechaniken, die auch im Bereich von professionellen Anwendungen angewandt werden. Grundsätzlich gilt: Alles, was in Spielen eingesetzt wird, kann auch im professionellen Umfeld implementiert werden. Im Folgenden beschreibe ich einige Beispiele für Spielmechaniken.
Avatare

Diese abstrakten Repräsentationen von Nutzer:innen dienen ganz einfach dazu, dass sie sich der Anwendung sofort vertrauter fühlen. Darüber hinaus ermöglichen Avatare den Nutzer:innen, ihren Kolleg:innen gewisse Einblicke zu gewähren, die sonst nicht ohne weiteres möglich wären. Wähle ich beispielsweise eine E-Gitarre als Avatar, so können die anderen Benutzer:innen einer Anwendung erkennen, dass ich musikalisch bin, Rockmusik mag, oder ähnliches. Solche Repräsentationen seiner selbst liegen dem Menschen. Uns ist immer daran gelegen, welchen Eindruck wir auf Andere machen. (Leseempfehlung hierzu: Wir alle spielen Theater von Erving Goffman)
Avatare finden wir in unzähligen Anwendungen. Angefangen von unserem Betriebssystem (sei es Windows oder Linux) bis hin zu allen denkbaren Anwendungen im Internet, in denen wir einen eigenen Account pflegen. Ein Beispiel aus meiner alltäglichen Arbeit ist Jira. Hier kann sich jede Person einen Avatar zuordnen und sich so selbst darstellen. Zeitgleich bringt der Einsatz von Avataren in Jira gleich noch einen weiteren Nutzen: Durch die Anzeige innerhalb eines Sprint-Boards wird so auf einen Blick klar, wer gerade woran arbeitet.
Fortschrittsanzeige
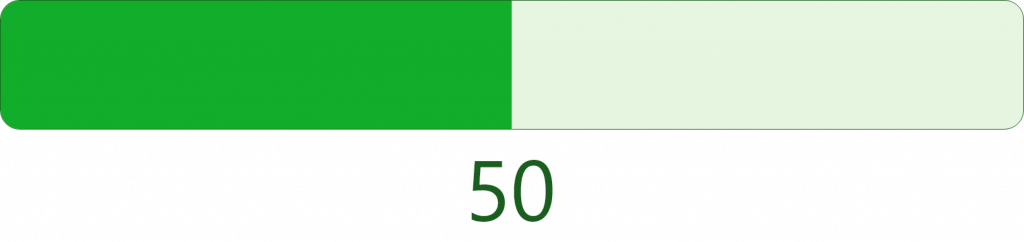
Mit Progress Bars wird der Fortschritt bis zum Erreichen eines bestimmten Ziels angezeigt. Selbstverständlich wird dieses Ziel von fachlicher Seite, also beim Design der Anwendung, definiert. Idealerweise entspricht es auch einem persönlichen Ziel der Nutzer:innen. Kleine Abweichungen können auf diesem Wege aber einfach ausgeglichen werden. Erfüllen viele Nutzer:innen einen Arbeitsschritt aus irgendeinem Grunde nicht gerne, so kann mit einer Fortschrittsanzeige doch eine gewisse Motivation dafür entstehen, sich doch damit zu beschäftigen. Viel nachhaltiger und besser wäre jedoch aus Usability-Sicht, diesen Arbeitsschritt zu analysieren und zu optimieren, sodass er den Erfordernissen der Nutzer:innen besser entspricht.
Zusätzlich können Fortschrittsanzeigen dazu führen, dass die Nutzer:innen sich herausgefordert fühlen. Dies ist ein besonders mächtiges Mittel, denn Menschen lieben die Herausforderung. Wenn wir uns herausgefordert fühlen, möchten wir uns und anderen gerne beweisen, dass wir dem gewachsen sind.
Ein Beispiel für Fortschrittsanzeigen findet sich auf LinkedIn. Im Abschnitt des eigenen Profils wird ein Fortschrittsbalken angezeigt, mit dem die Vollständigkeit des eigenen Profils dargestellt werden soll.
Punkte
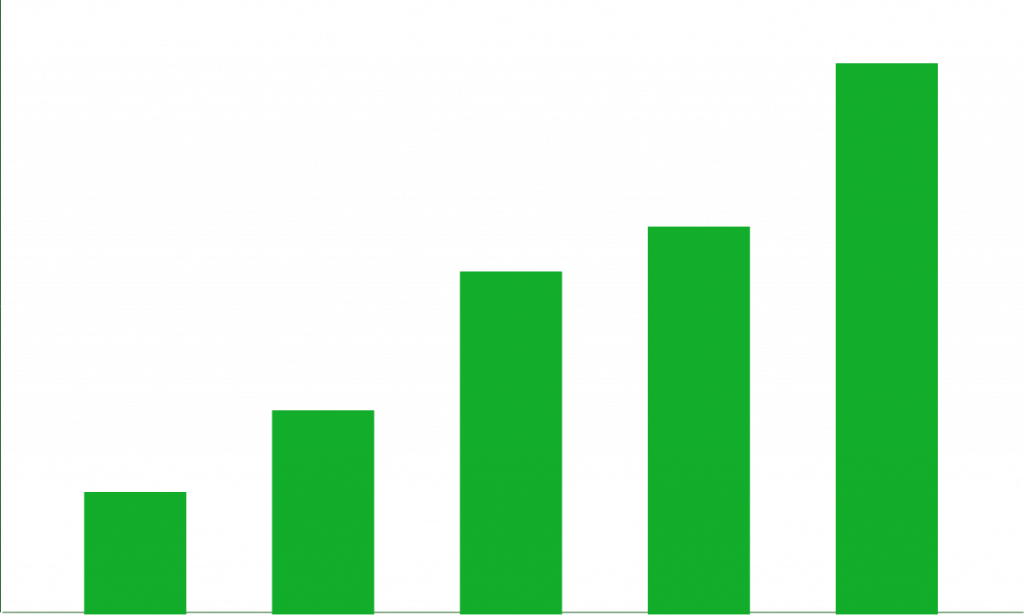
Die meisten Spiele nutzen das Konzept von Punkten. In klassischen Spielen gewinnen die Spieler:innen Punkte, wenn sie Aufgaben erfüllen oder Herausforderungen bestehen. Dasselbe Prinzip kann auch in professionellen Applikationen angewandt werden. Hier besteht allerdings die Gefahr, dass die Arbeit der Nutzer:innen mit der Anwendung unsauber wird. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass andere Stakeholder für besonders gute Arbeit Punkte vergeben.
Das zweitgenannte Prinzip ist so auch auf Stack Overflow zu finden. Hier können Nutzer:innen Fragen zu technischen und/oder technologischen Problemen stellen, andere können diese beantworten. Gute Antworten werden von Leser:innen und Mitdiskutierenden positiv, schlechte negativ bewertet.
Eine Punktewertung sorgt dafür, dass die Nutzer:innen gut und sauber arbeiten, damit sie von anderen Anwender:innen mit Punkten belohnt werden.
Rangliste

Menschen lieben die Herausforderung. Vor allen Dingen lieben wir es, uns mit anderen zu messen. Ranglisten liefern eine einfache Spielmechanik, um diese Vergleiche mit anderen schön darzustellen.
Wichtig ist hierbei, dass die Ranglisten so konstruiert sind, dass die Nutzer:innen sich immer nur mit angemessenen “Herausforderern” messen. Dies kann bspw. über Ligen, Gruppierung anhand individueller Punktzahlen, vorhandener Badges, etc. geschehen.
Ein gutes Beispiel für die Implementierung von Ranglisten findet man in Duolingo. Hier gibt es verschiedene Ligen, in denen die Nutzer:innen auf- und absteigen können. Innerhalb einer Liga befinden sich immer nur 20 bis 30 Nutzer:innen. Durch die Gruppierung innerhalb der Ligen sind die Nutzer:innen sehr gut miteinander vergleichbar. Dies kann sie zu einer intensiveren Nutzung motivieren.
Abzeichen

Mit Abzeichen (Badges) oder Stickern können Leistung und Fortschritt von Nutzer:innen angezeigt werden. Dies ist neben der Rangliste eine beliebte Spielmechanik, mit der Nutzer:innen sich untereinander vergleichen und so gegenseitig motivieren können.
Badges sind beispielsweise in Audible implementiert. Hier sind viele Abzeichen implementiert, die die Nutzer:innen über eine entsprechende Nutzung der Applikation gewinnen können. So wird die Nutzung der App durch die sehr anschaulichen Statisktiken noch weiter intensiviert.
Eigene Ziele

Eines der wirkungsvollsten Mechaniken ist es, die Nutzer:innen selbst ihre Ziele definieren zu lassen. Hierbei ist es besonders wichtig, dass das System hier geeignete Vorschläge macht. Die Ziele müssen für die Nutzer:innen erreichbar sein. Nur so lässt sich die intrinsische Motivation steigern.
Ist das (vom System) gesetzte Ziel zu hoch gesteckt, entsteht schnell Frust. Sind die vom System vordefinierten Ziele zu niedrig angesetzt, so können die Nutzer:innen sie stets anheben.
Ein Beispiel für selbst gesetzte Ziele bietet Fiat Eco:Drive. Hier können sich die Nutzer:innen selbst einen EcoIndex als Ziel definieren und das System gibt Ratschläge, wie dieses Ziel erreicht werden kann.
Mehr als nur Spiele
Gamification ist kein Allheilmittel. Es ist lediglich ein Werkzeug, mit dem eine gute Usability erreicht werden kann. Wichtig dafür ist, dass der Nutzungskontext der verschiedenen Nutzergruppen gut analysiert wurde. Schließlich ist es möglich, dass die Benutzer:innen durch Wettbewerb oder Spielmechaniken nicht motiviert sondern im Gegenteil zu Ablehnung führt. Dies kann natürlich durch eine sukzessive Implementierung teilweise entschärft werden.
Daher ist auch bei dem Werkzeug Gamification (wie bei allen anderen Werkzeugen im Kontext von Usability und User Experience auch) eine umfassende Analyse der Benutzer:innen und ihrer jeweiligen Nutzungskontexte essenziell. Entsprechend der Erfordernisse der Nutzer:innen können die jeweilig passenden Spielmechaniken ausgewählt und implementiert zu werden.
So kann Gamification dazu führen, die Akzeptanz von Benutzer:innen für die Anwendung zu erhöhen, die UX zu verbessern und damit die Produktivität zu steigern.
Links
- Erklärvideo der NNGroup zu Gamification
- UXDesign: Use some gamification to increase user experience and engagement
- UID: Gamification: A playful way to positive user experience
- UXPlanet: Gamification in UX increasing user engagement
- Interaction Design: Introducing game mechanics for gamification
- Usability Blog: Motivation von Innen: Wirksame Gamification-Features sind mehr als Ranglisten und Punkte
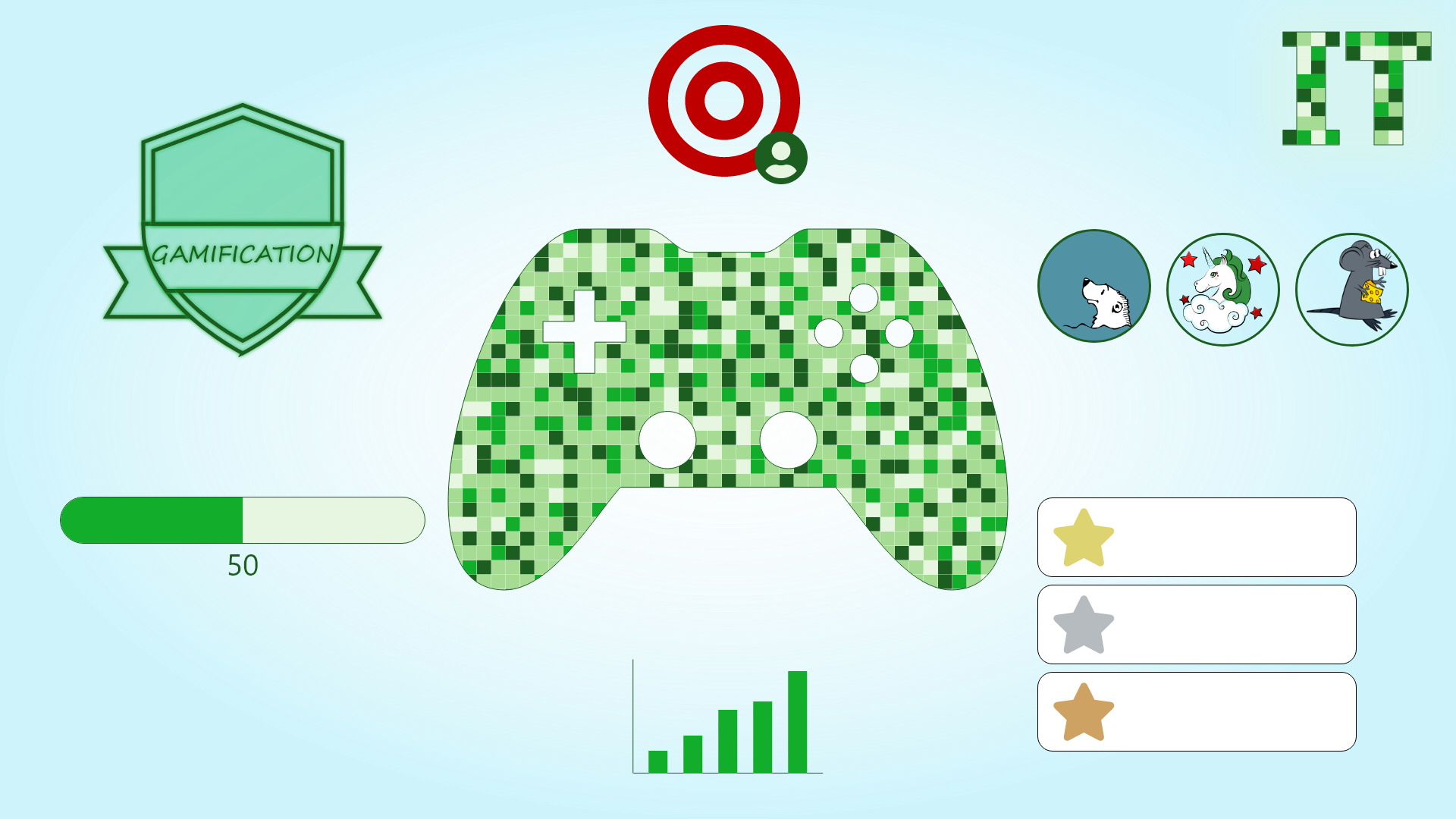
Schreiben Sie einen Kommentar